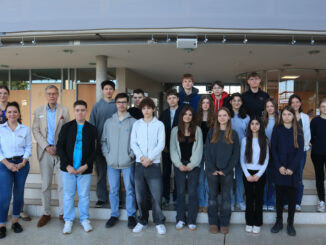Seit Kriegsbeginn sind mehr als tausend Menschen aus der Ukraine in Deutschland wegen ihrer Kriegsverletzungen behandelt worden. Yuily Schepetkin ist einer von ihnen. Er ist durch eine Landmine schwer verletzt worden und schließlich ins Klinikum Gütersloh eingeliefert worden.
Yuily Schepetkin hat fast keine militärische Ausbildung. Trotzdem fährt er am 9. September in der Nähe von Kurachowe in der Ukraine mit einem Pickup zwischen den Frontlinien hin und her, um Material zu transportieren. Sein Fahrzeug gerät auf eine Landmine, die explodiert. „Das war vermutlich eine Panzerabwehrmine, mein Fahrzeug war nicht gepanzert, ich hatte keine Chance“, erinnert er sich. Der Pickup wird durch die Luft geschleudert. Seine zwei Begleiter bleiben wie durch ein Wunder unverletzt. Yuily Schepetkin erleidet schwere Knochenbrüche, sein rechter Fuß ist zerfetzt, sein linker schwer verletzt.
Jetzt liegt er im Klinikum Gütersloh. Die Ärzte haben seine Brüche versorgt, seinen linken Fuß konnten sie retten, den rechten werden sie nicht retten können. Der Fuß muss amputiert werden. Zu stark sind die Verletzungen an Gewebe und Fußwurzelknochen.
Yuily Schepetkin ist vor drei Jahren freiwillig zum Militär gegangen. Als die russische Armee im Februar 2022 von Weißrussland aus auf Kiew zumarschiert ist, war seine Heimatstadt Bravari eine der letzten Bastionen vor der Hauptstadt. „Ich wollte nicht länger tatenlos zusehen, wie wir überfallen werden, ich wollte meine Familie und meine Freunde schützen“, sagt er. Ein paar Tage wurde er ausgebildet, dann ging es an die Front. Zuerst nach Bachmut, dann nach Wuhledar im Osten der Ukraine. Yuily Schepetkin bringt Medikamente und Material zu den Soldaten an die Front und transportiert Verletzte hinter die Frontlinien – bis er mit seinem Pickup über die Mine fährt.
Nach seiner schweren Verletzung beginnt für den 33-Jährigen eine Odyssee durch verschiedene Krankenhäuser in der Ukraine. Zunächst wird er in ein Militärkrankenhaus in der Nähe der Front im Osten der Ukraine gebracht, wo die Blutungen gestillt und der Bruch seines Oberschenkels notdürftig versorgt wird. Dann geht es weiter in ein Militärkrankenhaus in die Stadt Saporischschja, zwei Stunden westlich von Donezk, wo die Ärzte die Brüche seiner Füße versorgen. Schließlich landet er in einem zivilen Krankenhaus in der Nähe von Kiew, wo die Ärzte ihn insgesamt elfmal operieren, ohne Erfolg. „Eine Krankenpflegerin musste zwischen 40 und 50 Patienten versorgen, die Fenster waren teilweise kaputt, die Gebäude schwer beschädigt und es war überall kalt. Ich bin dem Arzt so lange auf die Nerven gegangen, bis er den Antrag für meine Verlegung nach Deutschland ausgefüllt hat.“ Seine Finger zittern, wenn er diese Geschichte erzählt. Denn er hat in diesem Krieg mehr als einmal erfahren, dass ein Zufall darüber entscheiden kann, ob man überlebt oder stirbt.
Über eintausend kriegsversehrte Menschen aus der Ukraine sind inzwischen in Deutschland versorgt worden. Koordiniert wird die Verlegung von Verletzten aus der Ukraine nach Deutschland vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Hier angekommen, wird nach dem sogenannten Kleeblatt-Prinzip verteilt, das sich während der Pandemie bewährt hat. Alle beteiligten Kliniken gehören zum Trauma-Netzwerk, dass die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) zur Versorgung Schwerverletzter aufgebaut hat. Viele Kriegsverletzte kommen mit gebrochenen Knochen und zertrümmerten Gelenken, zerfetzten Blutgefäßen, abgerissenen Gliedmaßen, Splittern im Körper und infiziertem Gewebe an: „Solche Verletzungen sieht man in Deutschland normalerweise nicht, sie bedeuten in der Regel große Schäden mit viel Blutverlust“, erklärt Dr. med. Philipp Bula, Chefarzt der Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, Orthopädie, Plastische-, Ästhetische- und Handchirurgie. Er hat bereits in seiner Zeit am Klinikum Dresden-Friedrichsstadt Erfahrungen in der Versorgung von Kriegsverletzten gesammelt. „Die ukrainischen Ärztinnen und Ärzte arbeiten unter hoher Belastung, für aufwendige Operationen oder gar eine Prothesenversorgung fehlen die Kapazitäten. Das bedeutet aber auch, dass wir als behandelnde Ärzte in Deutschland vor einer komplexen Aufgabe stehen, weil wir Menschen, denen Körperteile fehlen und die zum Teil mit multiresistenten Keimen belastet sind, bestmöglich helfen müssen.“
Für die Behandlung braucht es neben medizinischem Personal auch Menschen, die dolmetschen, und psychologische Betreuung, außerdem fällt jede Menge Bürokratie an. „Das ist nicht nur medizinisch, sondern auch strukturell eine Herausforderung“, erklärt Chefarzt Bula. Die Patienten aus der Ukraine haben kein Zuhause in Deutschland, wo sie bis zur Operation bleiben könnten. Die Stadt Gütersloh kümmert sich um die Anmeldung der Patienten zur Krankenversicherung.
Yuily Schepetkin hat Glück gehabt. Es geht ihm trotz seiner schweren Verletzungen inzwischen mental und körperlich gut. Die Wunden an seinem linken Fuß werden so gut verheilen, dass er mit einem orthopädischen Schuh gut gehen können wird. Für den linken Fuß wird nach der Amputation eine Prothese angefertigt, die ihm ein Leben ohne Rollstuhl ermöglicht. Dr. Philipp Bula: „Wenn der Krieg irgendwann vorbei ist, müssen diese Menschen wieder in der Lage sein, ein normales Leben zu führen und zum Beispiel körperlich zu arbeiten, wir tun alles dafür, damit das möglich ist.“
Yuily Schepetkin war vor dem Krieg Tischler. „Da muss ich den ganzen Tag auf zwei Beinen stehen und in der Lage sein, zu gehen.“ Er ist zum zweiten Mal verheiratet und hat drei Söhne. „Mein Lohn hat schon vor dem Krieg gerade für das Nötigste gereicht, eine Behinderung kann ich mir nicht leisten.“ Wenn seine Behandlung überstanden ist, will er nicht mehr zurück an die Front. „Ich habe getan, was ich konnte, jetzt ist es genug. Heute Morgen habe ich die Nachricht bekommen, dass zwei von meinen Freunden gefallen sind. Wenn wir die Gebiete, für die wir jetzt drei Jahre lang gekämpft haben, jetzt doch an Russland verlieren, wie sinnlos ist dann unser Kampf gewesen?“


Yuily Schepetkin ist einer von über tausend Kriegsverletzten, die mit schweren Verletzungen nach Deutschland gekommen sind.
(Fotos: Klinikum Gütersloh)